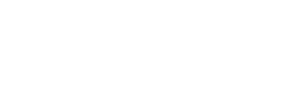Statistiken zufolge leiden in Deutschland mehr als 3 Millionen Menschen unter Essstörungen, an Magersucht, Bulimie und anderen teils lebensgefährlichen Krankheiten, die den Betroffenen, aber auch den Angehörigen und Freunden das Leben zur Hölle machen können. Trotz ihrer Häufigkeit werden Essstörungen dabei oft tabuisiert, aus Scham der Betroffenen oder einfach auch, um nicht dem gesellschaftlichen Ideal zu widersprechen, das heutzutage mehr denn je Schönheit mit Schlankheit identifiziert. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Angehörige und Betroffene das Schweigen brechen wie etwa Brigitte Reifetzhammer, die in ihrem Buch „Ich wäre so gerne satt“ den Kampf ihrer Tochter gegen die Magersucht beschreibt.

Essstörungen sind heimtückische Erkrankungen – oftmals entstehen sie unbemerkt und sind, wenn sie einmal Fuß gefasst haben, meist nur schwer zu kurieren. Etwa 600.000 Menschen leiden allein bei uns an der als Bulimie bekannten Ess-Brech-Sucht und über 100.000 an der gefürchteten Magersucht, die für etwa 10 Prozent der Betroffenen tödlich endet.
Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle für die Entstehung der so genannten „Anorexia nervosa“, der „nervlich bedingten Appetitlosigkeit“, die aber weit mehr ist als dieser Name auszusagen vermag. Das familiendynamische Modell betrachtet die Magersüchtigen, von denen 90 Prozent junge Frauen im Alter von 15 bis 35 Jahren sind, als „Symptomträger“, die in Familien mit übermäßigem Harmoniestreben krank werden, um die Familie durch die Krankheit zusammenzuhalten oder um auf die Weise Konflikte und Spannungen abzuleiten. Ein anderes Modell sieht in der Magersucht einen fehlgesteuerten Versuch zur Selbstbehauptung: Aufgrund einer Überangepasstheit in der Kindheit entwickelt die Erkrankte ein Ohnmachtgefühl gegenüber dem eigenen Körper, das über die Kontrolle der Nahrungsaufnahme und des Gewichtes kompensiert werden soll. Die Psychoanalyse wiederum betrachtet die Anorexie als Form der Ablehnung der eigenen Weiblichkeit und der Abwehr sexueller Wünsche – ein Ansatz, der erklären würde, warum die Krankheit so oft in der Pubertät ihren Anfang nimmt, weshalb die Monatsblutung bei den Betroffenen ausbleibt und wieso sexuelle Regungen von den Erkrankten häufig nicht oder nur angstbesetzt wahrgenommen werden.
Wie dem auch sei, die Krankheitssymptome sind meist eindeutig. Die Betroffenen leiden an einer Körperschemastörung, das heißt, sie nehmen sich trotz oft starkem Untergewicht als zu dick wahr. Ihr Selbstwertgefühl hängt nicht nur von allgemeinen Leistungen in Beruf, Hobby oder Privatleben, sondern besonders stark auch von der Fähigkeit ab, das Körpergewicht kontrollieren zu können. Etwas, das in der heutigen Zeit leider auch noch von den Medien und der Werbung gefördert wird: Nicht nur viele Schauspielerinnen und Models sind spindeldürr und leiden oft selbst an Bulimie oder Anorexie – sogar unsere Schaufensterpuppen haben heute 10 Zentimeter weniger Hüftumfang und 5 Zentimeter dünnere Oberschenkel als in den 20er Jahren! Im Vergleich zu lebendigen Frauen messen sie somit 13,5 Zentimeter weniger um die Hüfte und haben 10 Zentimeter dünnere Oberschenkel – wen wundert es da, wenn gerade heranwachsende Mädchen im Angesicht all dieser „Vorbilder“ ihre eigenen Körper immer schlechter ein- und wertzuschätzen wissen?
Doch magersüchtig zu sein bedeutet viel mehr als nur untergewichtig und dünn zu sein. Brigitte Reifetzhammer, deren Tochter Judith unter der tückischen Krankheit litt, beschreibt das Leiden überaus eindrucksvoll: „ Das gesamte Denken, Fühlen und Handeln dreht sich nur noch um die Themen Essen und Gewicht. Eine Krankheit, die es nicht zulässt, ein erfülltes Leben zu führen. Sie führt unweigerlich in die Isolation. Eine Sucht, die den Mangel, den Verzicht bis zur Kasteiung, Selbstbestrafung propagiert und unmenschliche Disziplin bis in den Tod fordert. Ein Schattendasein, im wahrsten Sinne des Wortes. Lange versteckt und perfektioniert hinter einer glaubwürdigen Fassade. Wenn die Krankheit soweit fortgeschritten ist, eröffnet sich uns eine Welt, die voller Not und Verzweiflung ist.“
Wie gut sich die Krankheit selbst vor den nächsten Angehörigen verstecken kann, musste Brigitte Reifetzhammer auf die harte Tour lernen, nämlich durch den gescheiterten Selbstmordversuch ihrer Tochter – ein drastischer Hilferuf, der gleichzeitig aber auch der Anfang eines Kampfes um Heilung war. Judith, die „Hauptdarstellerin wider Willen“, wie sie es selbst nennt, kommt im Buch ihrer Mutter immer wieder zu Wort und zwar in Form von Auszügen aus ihren Tagebüchern. Darin beschreibt sie ihr Leiden und dass sie schon in ihrer frühen Kindheit das Gefühl hatte, „anders“ und irgendwie „unzulänglich“ zu sein. „In mir wuchs zuerst die Vermutung und dann die Gewissheit“, berichtet Judith, „dass mir etwas Grundlegendes fehlt, um als vollwertiges Gruppenmitglied anerkannt zu werden. Ich begann, mich damit abzufinden, dass ich ein Problemkind bin und deshalb auch mein Leben nicht so bunt und fröhlich ist wie das der anderen Kinder rundherum. Für mich war es ganz logisch, dass ich keinen Anspruch auf Hilfe hatte. Denn der Anspruch auf Hilfe setzt einen guten Platz voraus und diese Sicherheit fehlte mir vollkommen. So habe ich begonnen, alles mit mir alleine auszumachen. Niemanden belästigen, niemanden auf die Nerven gehen. Das hat mich mit der Zeit stumm werden lassen.“
| „Alles was schlecht an mir ist, kommt aus meinem Körper. Atmen, essen, ausscheiden, sexuelle Lust …“ |
In schonungsloser Offenheit berichtet die Protagonistin von ihren Selbstzweifeln, von ihrer „Gier“ und „Triebhaftigkeit“, die sie unterdrückt, und davon, was sie über ihren Körper denkt: „Alles was schlecht an mir ist, kommt aus meinem Körper. Atmen, essen, ausscheiden, sexuelle Lust. Nun ist er an der Reihe. Jetzt muss ich ihn in den Griff bekommen. Die Emotionen, die aus der Seele kommen, habe ich schon aus dem Weg geräumt. Den Geist habe ich gereinigt von all den Dingen, die ich für schlecht befunden habe. Meine Gefühle habe ich erfolgreich verleugnet, jetzt sind nur noch die nackten Fakten übrig. Aber die Triebe, die aus meinem Körper kommen, der Hunger, das Verlangen, die habe ich noch nicht unter Kontrolle. Sie sind widerwärtig und ich bin ihnen ausgeliefert. Damit muss Schluss sein. Ich muss meinen Körper als Quelle dieses Unheils bestrafen.“ All dies trieb sie in die Magersucht, in die Depression und sogar zum versuchten Suizid. Ein zwanghaftes Verhalten und gleichzeitig stummes Leiden, dass seiner eigenen perfiden Logik folgt. Aber auch ein Weg zur Heilung, der sie über die Psychiatrie in eine psychosomatische Klinik führte, in der ihr schließlich geholfen werden konnte – aber nur, nachdem sie sich selbst dafür entschieden hatte, zu leben. „Alleine kann man es nicht schaffen“, schreibt Judith, „man muss es auch nicht. Aber wollen muss man es, ganz, ganz fest.“

„Besonders erlösend war für mich das Erkennen“, sagt sie über einen wichtigen Schritt zu ihrer Heilung, „dass ich Opfer der Krankheit geworden war. Bis dahin hielt ich mich für die Täterin, die sich ihr Los selbst ausgesucht hatte, Sadistin und Masochistin in einer Person. Wahr war vielmehr, dass ich etwas ganz Normales getan habe, was alle Menschen andauernd tun: essen. Ganz einfach essen und es sich schmecken lassen. Was für andere eine Wohltat, ein Genuss ist, war für mich die elfte Todsünde. Sie verdiente die Höchststrafe: Selbsthass.“
Auf der anderen Seite konfrontiert uns Brigitte Reifetzhammers Buch mit der Sicht der Mutter, mit der ständigen Frage nach dem „Was habe ich nur falsch gemacht?“ und der Erkenntnis, dass man als Elternteil nicht bei der Schuldfrage Halt machen darf. „Den oder die Schuldigen zu finden, bringt uns und unser Kind nicht weiter“, schreibt Reifetzhammer. „Was wir tun müssen, ist Verantwortung übernehmen. Für unser Tun wohlgemerkt, nicht für das, was unser Kind tut. Dazu muss es selber stehen lernen. Das ist die große Herausforderung.“
Hierzu passt auch die dialogische Form des Buches, in dem sich die Berichte der Mutter mit den Tagebucheinträgen der Tochter abwechseln und sich gegenseitig ergänzen. Auch wenn Judiths Leidensgeschichte und Heilungsweg sicher einmalig sind, so bekommt man doch einen Einblick in die Psyche einer von der Magersucht gequälten Seele, ebenso wie in die perfide Logik der Krankheit und ihre direkten und indirekten Auswirkungen auf das Umfeld und die Angehörigen. „Ich wäre so gerne satt“ ist ein Mut-Mach-Buch für Betroffene, Eltern, Angehörige, Freunde, Pädagogen und Interessierte – und es ist ein mutiges Buch. Über das innere Grauen zu reden, fällt nämlich magersüchtigen Menschen unheimlich schwer, und doch ist es ihr größter Wunsch, dass jemand kommt und sagt: „Vertrau mir, ich helfe dir!“
So antwortet Judith auch auf die Frage, was andere tun können, um zu helfen: „Ganz eindeutig: reden und neugierig zuhören. ‚Zeig mir deine Welt, erzähl mir mehr darüber. Lass mich teilhaben, denn ich bin interessiert, was in dir vorgeht.’ Mag sie für den Zuhörer auch noch so unverständlich und abstrus sein, für den Betroffenen ist sie Wirklichkeit. Sie ist alles, was er hat. Ohne sie ist er nichts. Bevor er sie aus der Hand geben kann, braucht er die Idee für eine neue Welt. Und für diese Neukonstruktion braucht er ein Team: Spezialisten, Förderer und Vertraute.“ Und den Betroffenen, die wieder gesund werden wollen, rät sie: „Zu allererst braucht es die persönliche Entscheidung, sich helfen zu lassen bzw. die Ermutigung von Familie, Freunden, Kollegen, professionelle Hilfe anzunehmen. Dann ein offenes Gespräch ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisung, ohne pseudo-therapeutische Ratschläge. Denn niemand, kein Außenstehender hat auch nur den blassesten Schimmer, für welche inneren Wunden sich die Magersucht als vermeintliche Lösung anbietet. Das ist nur mit therapeutischer Hilfe möglich.“
Weitere Informationen:
www.magersucht-online.de
www.hungrig-online.de
‚„Ich wäre so gerne satt“ – Meine Tochter besiegt die Magersucht'“
141 Seiten, € 14,50
ISBN 978-3-85068-836-9
Ennsthaler