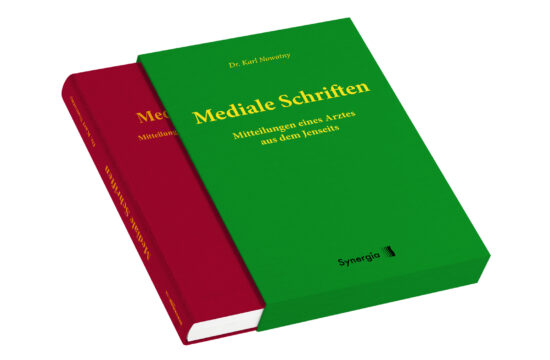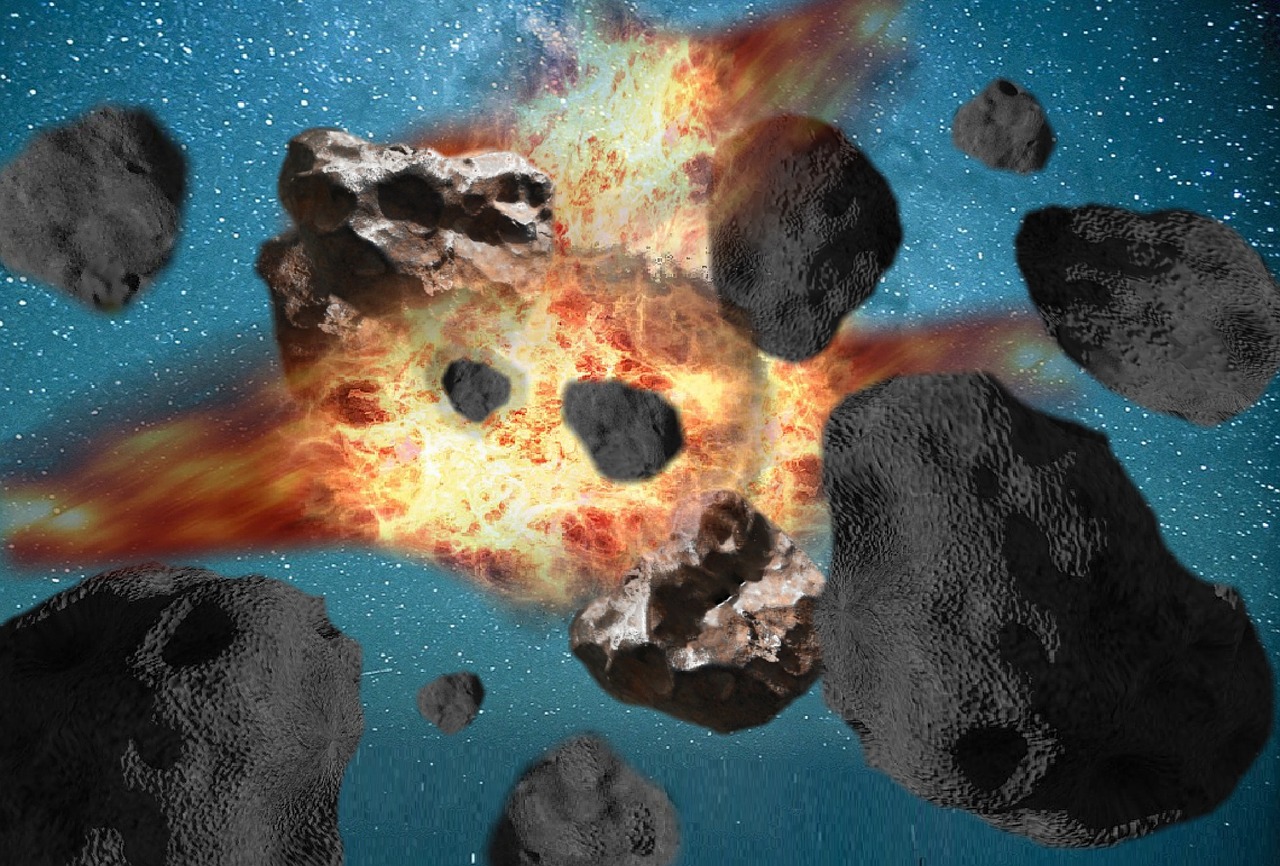Der preisgekrönte Journalist und Fotograf Jaimal Yogis verbringt seine Freizeit am liebsten mit Zen, Surfen und Reisen. Jetzt hat er mit „Surfing Buddha“ ein Buch geschrieben, das seine Leidenschaften verbindet – ein „Loblied auf das Wasser“, wie er selbst sagt. Oberflächlich betrachtet ist es eine Sammlung kurzer Erzählungen über seine Begegnungen mit dem Meer und seiner Zen-Praxis. „In der Tiefe aber ist es einfach eine Predigt über das Wasser“, betont Jaimal, „jene Substanz, die das Leben erhält.“ In folgendem Artikel berichtet er von der Weisheit der Wellen und vom Wesen des Zen.
„Wenn du zum Ozean zurückkehrst“, schreibt Thomas Farber in On Water, „dann erlebst du eine deiner wichtigsten Erinnerungen noch einmal neu, etwas, das dir einstmals sehr vertraut war – und dir wird klar, dass du dich ein Leben lang zu erinnern versucht hast.“ Ich finde gut, dass Farber schreibt „dir wird klar, dass du dich ein Leben lang zu erinnern versucht hast“ und nicht „dir wird klar, an was du dich ein Leben lang zu erinnern versucht hast“. Darin ruht die schlichte Wahrheit, dass du, sobald du dich vom Meer entfernst, nur allzu schnell vergisst, wonach du Heimweh hast. Doch die Spuren dessen sind stets präsent. Und wenn du zurückkehrst, sind da die salzige Luft, das unablässige Rauschen der Wellen, das, was Mark Twain als „die klaren Tiefen“ bezeichnet.
Basho, ein Zen-Mönch des siebzehnten Jahrhunderts, sagt in einem Haiku:
Mutter, die ich nie gekannt
Jedes Mal, da ich den Ozean erblicke
Jedes Mal
Vielleicht ist es unumgänglich, dass wir, die wir uns aus wasserhaltigen Amöben entwickelt haben und auch heute noch zu zwei Dritteln aus Wasser bestehen, eine so enge Verbindung zum Ozean spüren. Vielleicht sind wir gar ein Teil im großen Plan des Wassers. Tom Robbins meint, dass Menschen (ebenso wie jedes andere Lebewesen) „vom Wasser geschaffen wurden, damit es sich selbst von Ort zu Ort transportieren kann.“
Farber erinnert uns daran, dass wir gar nicht so sehr vom Meer abgetrennt sind, wie wir vielleicht denken: Unsere Haut ist so glatt wie die eines Delfins oder eines Wals; wir können schwimmen; wir sind stromlinienförmig gebaut und von einer subkutanen Fettschicht umhüllt; sogar unser Blut entspricht der Beschaffenheit von Meerwasser. Und wie in den letzten Jahren von Freitauchern bewiesen wurde, sind wir sogar in der Lage, unsere Herzfrequenz genau wie Delfine und Wale derartig zu verlangsamen, dass wir in große Tiefen vordringen können – tiefer als 120 Meter ganz ohne Sauerstoff.
Zen – dieses Wort ist heutzutage weit verbreitet und wird scheinbar meist zu Werbezwecken verwendet, wie in der aktuellen Werbekampagne für MP3-Player – Find Your Zen – oder es dient als Name für Restaurants wie in San Francisco – Hana Zen, Now and Zen. Leider sind die meisten Menschen völlig ahnungslos, was Zen eigentlich bedeutet. Manchmal kommt es mir so vor, als wüsste ich es selbst nicht. Natürlich weiß ich, was das Wort bedeutet. Im wörtlichen Sinne ist Zen der japanische Ausdruck für einen Begriff aus dem Sanskrit, Dhyana, was sich frei als Meditation übersetzen lässt. Besser übersetzt, bedeutet Dhyana allerdings Konzentration in ihrer Vollkommenheit, wie ich von einem meiner wissenschaftlich versiertesten Meditationslehrer erfahren habe, eine Konzentration also, die vielmehr umfassend ist als einschränkend.
Der Zen-Buddhismus entstand in China etwa im vierten Jahrhundert nach Christus, als ein südindischer buddhistischer Mönch namens Bodhidharma angeblich die Lehre des Nur-Geist einführte und damit eine neue Linie im Buddhismus begründete. Durch ihre Einfachheit, Strenge und ihren Esprit konnte diese Tradition gedeihen und verbreitete sich schließlich in großen Teilen Asiens und erreichte im vergangenen Jahrhundert endlich auch Amerika.
Zen ist allerdings mehr als nur eine Strömung, mehr als einfaches Stillsitzen. Es ist weitaus mehr als ein ästhetischer Ausdruck und sicherlich mehr als ein Marketingkonzept. Und seine Definition ist möglicherweise ebenso unmöglich zu beschreiben wie seine Kernlehre. Einer der größten Vorreiter des Zen in Amerika, Shunryu Suzuki Roshi, sagte oft, Zen erkläre sich am besten selbst, wenn man einfach nur dasitzt.
Meiner bescheidenen Erfahrung nach ist Zen-Praxis so etwas wie die Rückkehr zum Wasser, es ist wie das Hinauspaddeln in die Brandung nach vielen Tagen ohne Wellen. Matthieu Ricard, der französische Biologe, der unter dem Dalai Lama ordinierte, beschreibt die Stufen der Meditation: „Schließlich wird der Geist wie das Meer bei ruhigem Wetter. Ab und zu kräuseln kleine Wellen abschweifender Gedanken seine Oberfläche, in der Tiefe aber herrscht ungestörte Stille.“ Wenn ich ganz still im Zazen oder auf meinem Surfbrett sitze, wird mir bewusst, dass ich viel zu lange von mir selbst entfernt war, dass ich viel öfter dorthin zurückkehren sollte. Für mich macht es durchaus Sinn, dass Surfen und Buddhismus einander in handfester Gestalt begegnen sollten, in Form eines Buches. „Das Surfen ist vor allen Dingen ein Glaube“, sagte Sam George, der frühere Herausgeber des Magazins Surfer. Und Surfer klingen oftmals wie Buddhisten, wenn sie von ihrer Kunst erzählen. „Und dann löste die Welt sich in Luft auf “, schreibt Steven Kotler in seinem Buch über das Surfen, West of Jesus. „Da war kein Selbst mehr, kein Anderer. Für einen Augenblick konnte ich nicht mehr sagen, wo ich aufhörte und wo die Welle begann.“
Das Foto, auf dem die Profisurfer Dick Brewer, Gerry Lopez und Reno Abellira am Fuße des Mount Tantalus mit gekreuzten Beinen neben ihren Surfbrettern sitzen und meditieren, hat sich wohl jedem Surfer tief eingeprägt. In der jüngeren Vergangenheit wurde der meditierende Profisurfer Dave Rastovich („Rasta“) zu einer Art Schutzpatron seines Sports: Er lehrt andere Surfer verschiedene Formen der Meditation und hilft in seiner Freizeit bei der Rettung von Delfinen und Walen.
Auf der anderen Seite benutzten viele buddhistische Lehrer den Vergleich mit dem Wasser, um Buddhas Lehren verständlich zu machen: Unbeständigkeit („Die Myriaden von Welten sind wie der Schaum des Meeres“, schrieb der chinesische Meister Yung-Chia im achten Jahrhundert), Karma und Reinkarnation (die Lebenskraft eines Menschen wird „das nächste Leben hervorbringen, so wie eine Welle die nächste Welle hervorbringt. Diese Energie wird niemals verschwinden, sondern sich immerfort in neue Leben ergießen“, heißt es im zwanzigsten Jahrhundert bei Meister Hakuun Yasutani) und die grundlegende Buddha-Natur im Wesen eines jeden von uns (sie „ist wie das Meer und jedes Individuum ist wie eine Welle an der Oberfläche des Ozeans“, sagt Yasutani).
Mein absolutes Lieblingszitat zum Thema Zen und Surfen stammt jedoch von Suzuki Roshi, einem der Menschen, die dem Zen via Kalifornien – wo auch sonst? – den Weg nach Amerika bereitet haben. Suzuki gründete das Tassajara Zen Centre in Big Sur (in der Nähe eines der besten Surfgebiete an der Westküste) und mir gefällt der Gedanke, dass er wohl an Surfer gedacht haben könnte, als er Gedankenwellen mit den Wellen des Ozeans verglich. Er sagte: „Auch wenn die Wellen sich erheben, bleibt die Essenz des Geistes doch rein … Wellen sind die Bewegung des Wassers. Wenn du von Wellen ohne Wasser sprichst, ist das ebenso irreführend, als sprächest du von Wasser ohne Wellen.“
Genau: Genug geredet von seichten, ruhigen Teichen, in denen sich das Mondlicht spiegelt. Reden wir lieber von Wellen, von der spiegelglatten Meeresoberfläche und wie sie lebendig wird durch die wogende Dünung. Wenn Wellen die Bewegung des Wassers sind und Gedanken die Bewegung des Geistes, wäre es dann nicht herrlich, wenn jeder von uns Surfen lernte?
Es gibt Menschen, die sagen, das „Ziel“ des Buddhismus sei es, selbst zum Buddha zu werden – also zu erwachen. Und eine der allerersten Lehren des historischen Buddha, wie sie im Avatamsaka Sutra aufgezeichnet ist, besagt: „die Erde erklärt Dharma“, was, wie ich glaube, bedeutet, dass allein schon die Welt, in der wir leben, uns zeigt, wie Erwachen funktioniert. Und da der größte Teil der Erde vom Ozean bedeckt ist, glaube ich, dass es nicht übertrieben ist zu behaupten, dass du mit der richtigen Absicht und dem richtigen Bewusstsein beim Spiel mit den Wellen zum Buddha werden kannst.

Ich wurde von meinen Eltern in die Welt des Buddhismus eingeführt. Aber ich verliebte mich in ihn, als ich auf der Highschool war und mich mit der Beat-Generation beschäftigte. Ich weiß noch genau, wie ich Kerouacs Gammler, Zen und hohe Berge las und fast weinte vor Freude, als Japhy (nach dem Vorbild des Beat-Dichters Gary Snyder) zu Jack sagt: „Ich lerne meine Bodhisattvas immer auf der Straße kennen!“ Ich konnte ja wohl kaum eine religiöse Tradition ergründen, in der ich die Wahrheit ganz allein finden sollte, ganz von selbst. Bald schon fand ich heraus, dass der historische Buddha betonte, dass ich sie sogar ganz allein finden musste. Sicher konnte ich Hilfe erwarten von den Drei Juwelen: Buddha, Dharma (den Lehren) und Sangha (der Gemeinschaft der Praktizierenden). Aber letztendlich hält uns Buddha dazu an, alles selbst auszuprobieren und eigene Schlüsse zu ziehen.
Die letzten Worte, die Buddha auf seinem Sterbebett sprach, lauteten: „Nichts, was ist, ist von Dauer. Sei fleißig und finde für dich heraus, worin dein Seelenheil besteht.“ So lächerlich es auch sein mag, ich glaube, dass ich genau das tue, wenn ich auf den Wellen reite und über den Saum unserer blauen Welt gleite.
Weitere Infos unter:
www.surfing-buddha.de
www.jaimalyogis.com
| BUCH-TIPP: |
| Jaimal Yogis |
| ‚Surfing Buddha – Der Ozean und die Welle des Zen‘ |
| 239 Seiten, € 18,00 |
| ISBN 978-3-89901-292-7 |
| Aurum Verlag |
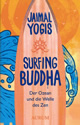 |