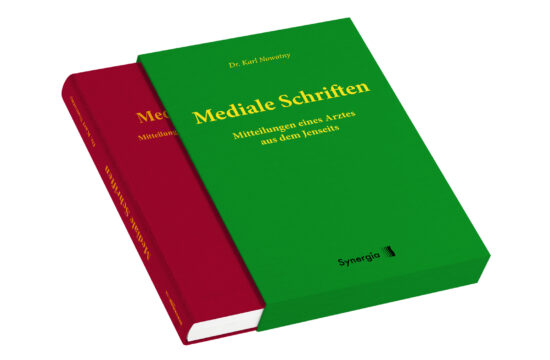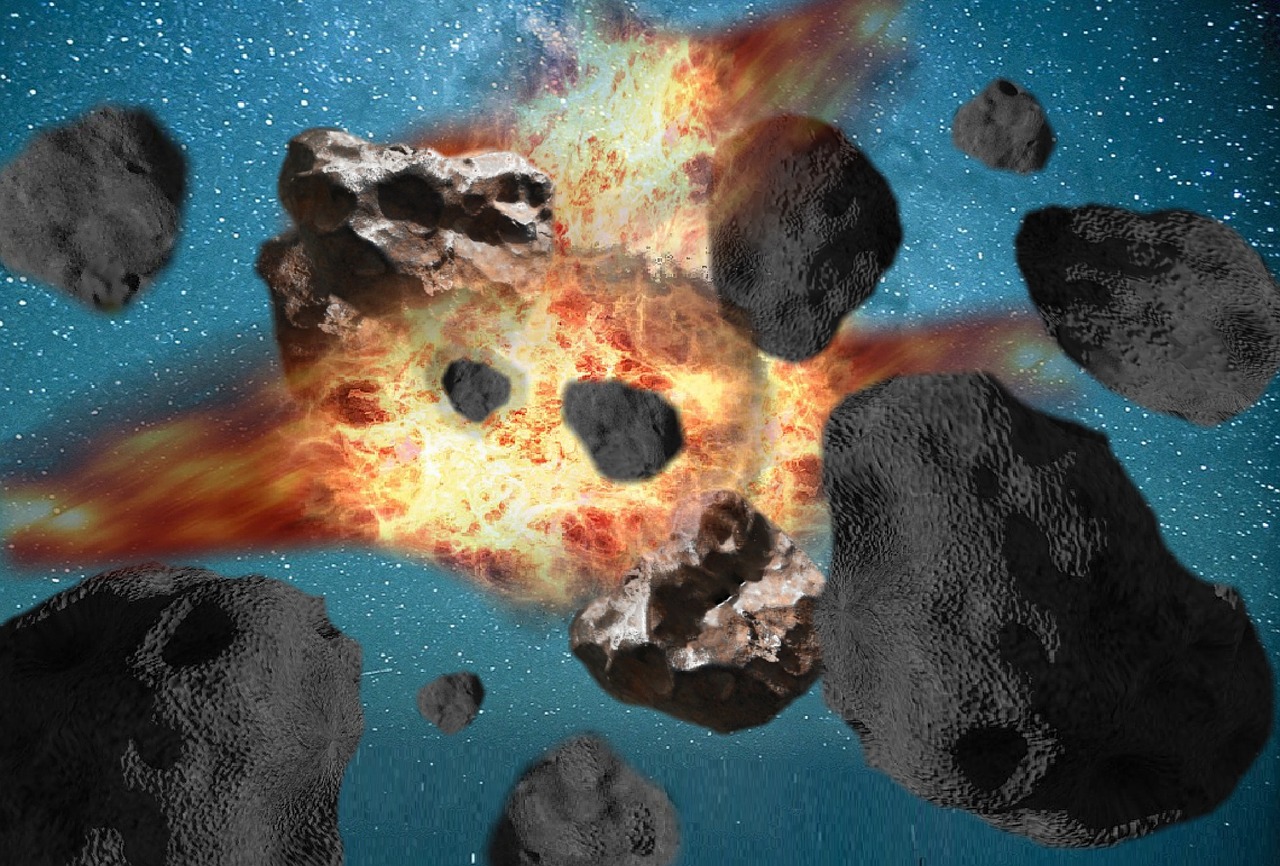Historischer Ethno-Roman, Thriller und Liebesgeschichte – Autorin Susanne Aernecke hat einen Sommerroman mit Spirit geschrieben, der vieles bietet. Über die Zeiten hinweg entfaltet sich eine Story, die das Schicksal zweier Frauen durch einen Zauberpilz miteinander verbindet. Der psychotrope und heilkräftige Pilz, »Amakuma« genannt, wird von Iriomé, der letzten Hohepriesterin der kanarischen Ureinwohner von La Palma gehütet. Als die Spanier ihre Heimatinsel La Palma erobern, wird sie von der Inquisition angeklagt und von der Liebe ihres Lebens verraten. Jahrhunderte später greift das Schicksal wieder ein und holt die Geheimnisse um Amakuma ans Licht. Die Ärztin und Pharmaforscherin Romy wird von rätselhaften Träumen nach La Palma geführt und findet Amakuma. Sie möchte den Pilz als Heilmittel testen – und ahnt nicht, dass ihr längst Pharmakonzerne auf den Fersen sind. newsage stellt Ihnen exklusiv einen Ausschnitt aus »Tochter des Drachenbaums« vor. Viel Freude beim Lesen!
 Sie verstaute ihren Rucksack in einer kleinen Höhle und rieb ihre Hände mit Kreide ein. Ein eisiger Wind biss sich durch ihre bunte peruanische Wollmütze mit den Ohrenklappen. Erwartungsvoll streckte Romy ihr Gesicht der Sonne entgegen, die sich wie ein glühender Feuerball in diesem Moment über die zerklüfteten Gipfel des Karwendelgebirges schob. Das Rosa der Morgendämmerung war einem frischen Blau gewichen, gegen das sich nun leuchtend weiß die teils verschneiten Kalksteinfelsen abhoben. Sie sog das farbenprächtige Bild in sich auf und war froh über ihren Entschluss, hierher gefahren zu sein. Es war Montagmorgen, und sie würde die Wand wahrscheinlich ganz für sich haben. Und genau das brauchte sie auch.
Sie verstaute ihren Rucksack in einer kleinen Höhle und rieb ihre Hände mit Kreide ein. Ein eisiger Wind biss sich durch ihre bunte peruanische Wollmütze mit den Ohrenklappen. Erwartungsvoll streckte Romy ihr Gesicht der Sonne entgegen, die sich wie ein glühender Feuerball in diesem Moment über die zerklüfteten Gipfel des Karwendelgebirges schob. Das Rosa der Morgendämmerung war einem frischen Blau gewichen, gegen das sich nun leuchtend weiß die teils verschneiten Kalksteinfelsen abhoben. Sie sog das farbenprächtige Bild in sich auf und war froh über ihren Entschluss, hierher gefahren zu sein. Es war Montagmorgen, und sie würde die Wand wahrscheinlich ganz für sich haben. Und genau das brauchte sie auch.
Die ersten zwei Kalksteinschuppen waren nicht größer als Streichholzbriefchen. Sie spreizte ihre Finger wie Greifhaken und belastete die Vorsprünge, während sie den Oberkörper anspannte. Dann stellte sie die Schuhspitze auf eine leichte Wölbung im Fels, zog an und drückte sich nach oben. Als Nächstes griff sie mit der anderen Hand über sich und legte die Finger in eine taubengroße Delle in der Wand, presste die Fingerspitzen in die Einbuchtung und stieg höher. Diesen Ablauf wiederholte sie Tritt für Tritt, Griff für Griff. Dennoch war keine Bewegung wie die andere.
Als sie ungefähr acht Meter über dem Waldboden war, kreischte ein Schwarm Bergdohlen über ihr und holte sie aus ihrem Flow. Der eisige Wind zerrte an ihrer Jacke. Romy spürte plötzlich ihren Herzschlag und warf einen Blick nach unten. Ein schon lange nicht mehr erlebtes Gefühl überschwemmte ihren Körper wie eine Welle. Und eine schon lange nicht mehr gehörte innere Stimme flüsterte ihr zu: Jetzt passiert etwas!
Ihr wurde heiß und kalt zugleich. Ihr Kopf begann zu dröhnen. Eine unsichtbare Schlinge zog sich immer fester um ihren Hals. Ihr Atem ging nur noch stoßweise, und jeder einzelne Muskel ihres Körpers verkrampfte sich. Auch wenn ihre Hände fest um zwei sichere Griffe lagen, stand sie in exponiertem Gelände, und der Wind fauchte ihr in die Ohren. Sie liebte diesen Spitzentanz über dem Abgrund. Er war ihre ganz persönliche Droge. Ihre Medizin gegen die Panikattacken, die sie in ihrer Jugend gequält hatten. Der perfekte Ausgleich zu ihrem Leben als Ärztin, die im nie endenden Laborbetrieb stets funktionieren musste. Doch plötzlich änderte sich etwas, und die längst verschwunden geglaubte Panik kehrte zurück, so sehr sie sich auch dagegen wehrte. Gedanken hämmerten wie ein Schlagbohrer rhythmisch auf sie ein: Jetzt fällst du runter! Jetzt erwischt es dich! Jetzt hast du das Rädchen überdreht!
Ihre Finger wurden steif, sie konnte sich kaum mehr halten. Gleich würde sie loslassen müssen. Alles loslassen. Sie schloss die Augen, drückte ihr Gesicht gegen den kalten Fels und zwang sich, gleichmäßig zu atmen. Eigentlich liebte sie es, das raue Gestein an ihrer Wange zu spüren. Doch jetzt trieb diese Berührung sie noch tiefer in die Panik. Warum nur hatte sie sich auf dieses Wagnis eingelassen? War sie etwa lebensmüde?
War in ihr etwas, das nicht mehr weitermachen wollte? Lag es daran, dass Thea seit Wochen im Krankenhaus lag und vielleicht an Krebs sterben würde? Dass sie sich ein Leben ohne ihre Freundin nicht vorstellen konnte? Die Angst ballte sich in ihrem Magen zusammen wie ein klebriger Teerklumpen. Romy zitterte am ganzen Körper, war nicht mehr in der Lage, Arme und Beine zu kontrollieren.
Wie der dunkle Schlund eines Raubtiers wartete unter ihr die Tiefe auf ihr Opfer, um es zu verschlingen. Sie presste den Bauch gegen den Fels, um Halt zu fi nden, und versuchte, ja keine ruckartige Bewegung zu provozieren, die sie aus ihrem labilen Gleichgewicht hätte bringen können. Doch ihre Finger rutschten über den rauen Fels, und ihre Füße verloren den Halt. Sie hörte ihren eigenen gellenden Schrei an den Felswänden widerhallen und ruderte verzweifelt mit den Armen, während sie in die Tiefe stürzte. Ihr letzter Gedanke war: Nicht auf den dicken Stein fallen!
Nebelschwaden zogen wie weiße Schleier über den gigantischen Vulkankrater, der von Höhlen durchzogen war. Ihre Eingänge sahen aus wie offene Münder von Toten, die man vergessen hatte zu schließen. In der größten Höhle waren die Anführer aller zwölf Stämme der kleinen Insel Benahoare zusammengekommen. Iriomé, für die es der siebzehnte Winter war, ließ den Blick über die bärtige Schar schweifen, die sich auf den Seegrasmatten niedergelassen hatte. Die Männer hatten sich fein gemacht für diesen Anlass und die langen Haare zu Zöpfen geflochten. Die Bärte, sonst wild und zerzaust, hingen wohlgeordnet bis auf die braun gebrannte Brust herab. Manche trugen sandfarbene, mit bunten Samenkapseln bestickte Ledergewänder, andere hatten zusammengenähte Ziegenfelle um ihre Lenden gebunden.
Es war der kürzeste Tag des Jahres, jener Tag, an dem Tichiname, die Oberste Medizinfrau, die Grenzen der Zeit überschreiten würde, um zu erfahren, was die Götter ihrem Volk vorherbestimmt hatten. Sie saß reglos mit geschlossenen Augen inmitten der Höhle vor einem mächtigen Feuer. Ihr von Wind und Wetter zerfurchtes Gesicht, umrahmt von krausem weißem Haar, war mit blauen Spiralen bemalt, dem Zeichen der Unendlichkeit und der ewigen Wiederkehr des Seins. Um ihren faltigen Hals trug sie eine Schnur mit getrockneten Eidechsen, und in der Hand hielt sie einen grob geschnitzten Stab, an dessen Spitze ein Ziegenschädel mit zwei spitzen Hörnern steckte.
Die Stammesführer hofften von ihr zu erfahren, was das nächste Jahr ihnen bringen würde. Ob sich ihre Ziegenherden vermehrten, ob die Frauen genug Wurzeln, Früchte und essbare Blätter finden würden, um Vorräte für entbehrungsreiche Zeiten anzulegen. Ob genug Kinder geboren würden. Und ob der Guayote, der Höllenhund, der im tiefsten Inneren des feuerspeienden Vulkans saß, friedlich bleiben und keinen von ihnen begehren würde.
Ohne Ankündigung ließ die Weise Frau einen schrillen Pfiff los, der an den steinernen Wänden der Höhle verhallte. Iriomé atmete tief durch. Es war so weit! Zum ersten Mal durfte sie dabei sein, wenn Tichiname den heiligen Trank Amakuna zu sich nahm. Sie hatte das Gebräu auf Anweisung der Medizinfrau so lange gekocht, bis der Schatten des Zeitstabes von einem Stein bis zum nächsten gewandert war. Und auch wenn sie noch nicht ganz verstand, was der Trank tatsächlich bewirken sollte, hoffte sie inständig, irgendwann einmal selbst damit eine Reise in jene geheimnisvollen Welten zu unternehmen, von denen Tichiname ihr immer wieder erzählt hatte. Doch bisher war sie nur die jüngste von sieben Schülerinnen, aus denen die Medizinfrau irgendwann ihre Nachfolgerin wählen würde.
Ein leises Summen erfüllte die Luft. Die sieben jungen Frauen standen Schulter an Schulter an den Wänden der Höhle und hoben die Arme. Ihre langen, aus gebleichten Pflanzenfasern gefertigten Umhänge breiteten sich aus wie die Flügel von Möwen. Ihre Lippen waren blau bemalt, und jede von ihnen trug um den Hals einen kleinen Lederbeutel mit getrockneten Kräutern. Iriomé schloss die Augen, während das Summen anschwoll und schließlich zu einer Art Gesang wurde, in dem sie und die anderen sechs ein einziges Wort im immergleichen Rhythmus wiederholten: »Amakuna, Amakuna, Amakuna …«
Trotz der kaum mehr erträglichen Lautstärke nahm Iriomé den Klang der kleinen Tonglöckchen wahr, die an Tichinames ledernem Gewand hingen. Offenbar hatte die Medizinfrau sich erhoben. Das dreimalige Klopfen ihres schweren Holzstocks auf dem Felsboden der Höhle ließ den Gesang verstummen. Iriomé öffnete die Augen, strich sich das lange rotblonde Haar aus dem Gesicht und trat nach vorn, um die ihr zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Stolz und aufrecht schritt sie zu der Felsnische, in der die Schale mit dem geheimnisvollen Gebräu stand. Ihr blieb dabei nicht verborgen, dass die dunklen Augen einer der Schülerinnen sie mit einem Blick verfolgten, der nichts Gutes verhieß. Sie wusste, dass der Neid Guayafanta fast zerfraß, denn sie glaubte, Anspruch auf Iriomés bevorzugte Stellung zu haben.
Zwei Talgfackeln beleuchten die Felswand, in die Dreiecke, Quadrate und konzentrische Kreise geritzt waren: Zeichen, durch die sich die Eingeweihten mit den Geistern verbinden konnten. Iriomé nahm den Deckel von der Schale und verrührte mit einem Holzlöffel die öligen gelben Schlieren auf der Oberfl äche. Dann nahm sie das Gefäß in beide Hände, kniete vor der Obersten Medizinfrau nieder und reichte es ihr. Gespannt beobachtete sie, wie ihre Lehrerin die Schale an die aufgesprungenen Lippen führte. Iriomé glaubte den leicht fauligen, erdigen Geschmack des Saftes wahrzunehmen, als rinne er durch ihre eigene Kehle. Nach einigen Atemzügen schoben sich Tichinames Pupillen nach oben. Nur mehr das Weiß ihrer Augen war zu sehen. Sie schien angekommen in der anderen Welt.
Plötzlich ertönte ein dumpfer Knall. Die Schale war zu Boden gefallen und in mehrere Teile zerbrochen. Iriomé zuckte zusammen und sah voller Schrecken, wie Tichinames Körper zu zittern begann, sich aufbäumte und wand, als wäre ein Dämon in ihn eingedrungen. Ihr Gesicht hatte sich zu einer hässlichen Fratze verformt. Schaum trat aus ihrem Mund. Sie keuchte, als kämpfe sie mit jemandem. Dann stürzte sie rücklings zu Boden. Iriomé sprang auf, um sie aufzufangen. Doch der von Krämpfen geschüttelte Körper entglitt ihr und prallte auf eine Felskante. Aus der Wunde am Kopf sickerte Blut, das Tichinames weißes Haar rot färbte. Sie heulte auf und rollte sich über den Boden hinaus aus der Höhle. Dort drückte sie sich hilfesuchend an den knorrigen Stamm eines gewaltigen Baumes, der mit seiner wuchtigen Krone wie ein Riese in das fahle Mondlicht aufragte.
Aus den erschrockenen Blicken der Anführer schloss Iriomé, dass dies nicht der normale Ablauf der Zeremonie sein konnte. Die Mädchen hatten sich entsetzt abgewandt, nur Guayafantas breites Gesicht mit den dunklen, undurchdringlichen Augen zeigte keine Regung. Iriomé vermochte sich nicht vorzustellen, was die Medizinfrau in der anderen Welt gesehen hatte, das einen solchen Ausbruch hervorrufen konnte. Keiner wagte es, sich ihr zu nähern.
Schließlich hielt Iriomé es nicht länger aus. Sie lief zu Tichiname, schmiegte sich an den noch immer stark zitternden Körper und versuchte, die Arme, die wie starke Taue um den Stamm geschlungen waren, zu lösen, doch ohne Erfolg. Erst nach einer ganzen Weile ließ die alte Frau los. Ihr Mund befand sich dicht an Iriomés Ohr, und so konnte sie hören, was ihre Lehrerin mit letzter Kraft flüsterte: »Es werden Männer mit Schiffen kommen, Männer, für die nur Macht und Reichtum zählen. Diese Männer kennen keine Liebe. Sie werden alles, was uns heilig ist, vernichten. Doch eines darf niemals in ihre Hände gelangen: Das heimliche Herz der Insel, das in der Höhle des höchsten Berges schlägt! Erst wenn die Menschen frei von Gier nach Macht und Reichtum sind, darf sein Geheimnis offenbart werden.«
Ihre Stimme wurde schwächer: »Es ist deine Aufgabe, als meine Nachfolgerin Amakuna so lange zu bewahren, bis jene Zeit gekommen ist.« Erschöpft von der Anstrengung des Sprechens fiel ihr Kopf nach hinten, so dass Iriomé ihn stützen musste. »Tichiname!«, schrie sie angsterfüllt. »Schwöre es«, stieß die Sterbende mit letzter Kraft hervor. Iriomé nahm deren faltige Hand und legte sie an ihr Herz: »Ich schwöre.« Ein tiefer Atemzug füllte den Brustkorb der alten Frau. »Vacaguaré«, hauchte sie in der Sprache ihres Volkes: »Ich möchte sterben.« Und dann noch einmal »Vacaguaré!«
»Nein«, flüsterte Iriomé verzweifelt. »Nein, geh nicht fort.« Tränen liefen ihr über die hohen Wangenknochen. Die blaue Farbe auf ihren Lippen war verschmiert, das Haar zerzaust. Sie presste sich mit dem Rücken an den Stamm des Baums, als könnte er neue Lebenskraft spenden, und blickte hilfesuchend in die Gesichter der anderen, die einen Kreis um sie gebildet hatten. Doch der Atem der alten Medizinfrau wurde mit jedem Zug flacher, bis er ganz aus ihr wich und sie zu Boden glitt. Iriomé brach schluchzend über ihr zusammen. Es war, als sei auch etwas in ihr gestorben. (…)
Zögernd öffnete Romy die Augen. Über ihr raues Gestein. Wasserrauschen. Sie brauchte lange Minuten, um sich zurechtzufinden. Wo war sie? Was war passiert? Nur langsam stieg die Erinnerung in ihr auf. Die Panik. Der Sturz. Der dicke Stein. Das Rauschen musste der Regen sein, der draußen vor dem Höhleneingang niederprasselte. »Starke Regenfälle am späteren Nachmittag«, erinnerte sich Romy an die Wettervorhersage, die sie am Morgen auf der Fahrt von Augsburg im Auto gehört hatte. Um die Zeit hatte sie eigentlich längst zurück sein wollen.
Behutsam bewegte sie den Kopf und nahm ein dumpfes Gefühl wahr sowie einen faulen, erdigen Geschmack in ihrem Mund. Sie spuckte aus, doch der Geschmack hielt sich hartnäckig auf ihrer Zunge. Ihr Blick fiel auf den kleinen Rucksack mit den Winterstiefeln, den sie hier in der Höhle neben dem Klettereinstieg zurückgelassen hatte. Doch wie war sie hierher gekommen? Totaler Blackout. Romy suchte nach einer Erinnerung. Doch da war nichts. Nichts außer dem Sturz …
Vorsichtig versuchte sie, einzelne Gliedmaßen zu bewegen. Zuerst die Finger, dann die Hände, Arme und die Beine. Erstaunlicherweise konnte sie sogar aufstehen – ohne einen Schmerz zu verspüren. Offensichtlich lief die Produktion der körpereigenen Betäubungsmittel auf Hochtouren. War das die berühmte »goldene halbe Stunde«, ein Geschenk von Mutter Natur an alle Verletzten, das sie in die Lage versetzen sollte, lebensrettende Maßnahmen zu ertragen? Unmöglich. Draußen dämmerte es bereits. Ein Blick auf ihre Armbanduhr sagte Romy, dass sie seit mindestens sieben Stunden hier lag. Sie hätte nicht einmal Medizin studieren müssen, um zu wissen, dass man nach einem Sturz aus acht Metern Höhe auf festgefrorenen Waldboden nicht einfach so davonkam.
Sämtliche Gliedmaßen hätten gebrochen sein müssen, Bänder gerissen, Muskeln geprellt, von inneren Verletzungen ganz zu schweigen. Sie hätte querschnittgelähmt sein können, wenn nicht gar tot. Auf keinen Fall aber wäre sie in der Lage gewesen, sich in die Höhle zu schleppen. Und auf keinen Fall hätte sie einfach so aufstehen können. Doch sie stand tatsächlich auf ihren eigenen zwei Beinen, wenn auch leicht gebückt, um mit dem Kopf nicht an die Höhlendecke zu stoßen. Jemand musste sie geradezu aufgefangen haben! Aber wie? Und wer?
Das war doch unmöglich. Und wieso hätte derjenige sie dann hier allein zurückgelassen? Es machte alles keinen Sinn. Dazu kam, dass ihr kein bisschen kalt war. Nach den vielen Stunden auf dem Boden der Höhle müsste sie eigentlich steif gefroren sein wie eine Tiefkühlpizza. Hatte sie den Sturz vielleicht ebenso geträumt wie das, was sie in den vergangenen Stunden in jener merkwürdigen Steinzeitwelt erlebt hatte? Doch Träume waren anders. Sowohl der Sturz als auch das, was sie durch die Augen dieses jungen Mädchens mit dem fremdartig klingenden Namen gesehen hatte, erschienen ihr ganz und gar real.
Wenn sie sich auch beim besten Willen nicht vorstellen konnte, in welchem Teil der Welt oder zu welcher Zeit sich jenes gruselige Ritual abgespielt haben könnte, dessen Zeuge sie gewesen war. Die Sprache war ihr völlig fremd, obwohl sie jedes Wort verstanden hatte. Und auch die Menschen, vor allem die alte Medizinfrau waren ihr irgendwie vertraut vorgekommen.

www.amakuna-saga.de